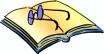 |
Bildung |
|
Bildung statt PISA – Seriosität statt Legendenbildung von Josef Kraus Präsident des Deutschen Lehrerverbandes 19. November 2008 Ganz so heftig wie in den Jahren zuvor waren Deutschlands PISA-Konvulsionen diesmal nicht. Von einem gelassenen Umgang mit PISA-Ergebnissen, wie man ihn in allen anderen Ländern der Welt pflegt, kann aber noch lange nicht die Rede sein. Also gingen bereits drei Tage vor dem jüngsten 18. November, vor der Bekanntgabe der neuesten Auswertung zu PISA 2006, publizistisch und politisch die Wogen hoch. Da wurde spekuliert, interpretiert, prognostiziert, natürlich auch ideologisiert, dass sich die Balken bogen. Selbst nach Vorliegen der Ergebnisse funktionierten die seit der ersten PISA-Testung von 2000 eingespielten Reflexe: Zur Weltspitze fehle den Deutschen immer noch ein großes Stück, schuld am schlechten Abschneiden mancher Länder seien die Hauptschulen, die Finnen mit ihrer Gesamt- und Gemeinschaftsschule seien uns eben haushoch überlegen, gute Bildung hänge immer noch sehr vom Geldbeutel der Eltern ab usw. „Getretner Quark wird breit, nicht stark.“ An dieses Goethe-Wort fühlt man sich bei so viel Quatsch erinnert. Da tut ein Blick in die Faktenlage not und gut. Worum ging es diesmal? Es ging um die Studie PISA-E 2006 mit Schwerpunkt Naturwissenschaften. Das E steht für Erweiterungsstudie. Das heißt: Die internationale PISA-Testung (PISA = Programme für International Student Assessment) war – wie bereits 2000 (Schwerpunkt Lesen) und 2003 (Schwerpunkt Mathematik) – um eine innerdeutsche Zusatzstudie ergänzt worden. Bei der international angelegten PISA-Studie waren in Deutschland knapp 5.000 Schüler aus 230 Schulen getestet worden, für die nationale PISA-E-Studie war die Stichprobe um 40.000 aus 1.300 Schulen erweitert worden. Zu den wichtigsten Ergebnissen: Sachsen hat innerdeutsch in allen drei Testbereichen (Naturwissenschaften, Lesen, Mathematik) mit Werten von 541 bzw. 512 bzw. 523 den ersten Platz errungen. Bayern folgt in dichtem Abstand mit 533 bzw. 511 bzw. 522 Punkten. Die dritten und vierten Plätze gingen an Baden-Württemberg und Thüringen. Dieses Länder-Quartett hatte bereits bei zurückliegenden Testungen die vorderen Plätze unter sich ausgemacht. Schlusslichter waren einmal mehr Hamburg und Bremen. Bleiben wir beim Schwerpunkt Naturwissenschaften: Hier kamen 14 der 16 Bundesländer über den OECD-Durchschnittswert von 500. Die Sachsen, die Bayern und die Thüringer nehmen mit ihren Werten auch in der internationalen Tabelle Spitzenwerte ein. Sie rangieren alle drei dicht hinter dem PISA-Sieger Finnland. Und: 14 der 16 deutschen Länder erreichen bzw. übertreffen das PISA-Ergebnis des seit Jahrzehnten hochgerühmten Schweden. Rekapituliert sei auch ein Ergebnis, das aus PISA 2006 bereits seit Dezember 2007 bekannt ist, damals aber aus durchsichtigen Gründen kaum kommuniziert wurde: Im Testbereich Naturwissenschaften hatten die verschiedenen Schulformen in Deutschland ein – erwartungsgemäß – sehr unterschiedliches Ergebnis erzielt. Die Hauptschulen waren auf 431, die Gesamtschulen trotz luxuriöser Personalausstattung auf 477, die Realschulen auf 525 und die Gymnasien auf 598 Punkte gekommen. Dem Gymnasium in Deutschland war damit – und dies ohne die sonst üblichen großen Unterschiede zwischen den deutschen Ländern und trotz unvermindert steigender Übertrittsquoten – erneut bestätigt worden, dass es die erfolgreichste Schulform der Welt ist. Unter dem Strich sind das durchaus passable Ergebnisse. Die Zeiten, in denen Deutschland sich im schulpolitischen Sündenstolz gekrampft zum absoluten PISA-Verlierer glaubte schlechtrechnen zu können, müssten insofern vorbei sein und einem Minimum an Rationalität Platz machen. Müssten! Denn manch journalistischem und politischem Nörgler passen diese Ergebnisse nach wie vor nicht in den Kram. Während die einen kaum verhohlen ihre Freude bekunden, dass die Bayern vom ersten Platz verdrängt wurden, sehen andere alle noch so schönen Ergebnisse überlagert von der angeblichen sozialen Ungerechtigkeit des deutschen Schulwesens. Wieder andere sehen den Erfolg der Sachsen als Ergebnis einer dort nicht vorhandenen Hauptschule, und flugs wird nach dem Finnland-Mythos bereits an einem neuen Mythos gestrickt, diesmal einem Sachsen-Mythos. All dies entbehrt der Grundlagen. Erstens sind die Bayern nicht abgestürzt, sondern dicht hinter den Sachsen. Dass die Bayern diesmal Zweiter wurden, ist vielleicht gar nicht so schlecht, denn sonst könnten sie sich womöglich noch mit ihren jüngsten schulpolitischen Fehlentscheidungen (siehe achtjähriges Gymnasium) bestätigt fühlen. Zweitens kann man – auch wenn es so mancher nicht verstehen will – die soziale Durchlässigkeit eines Schulwesens nicht mit PISA messen. PISA testet schließlich Fünfzehnjährige und setzt deren Testergebnisse in Beziehung zum schichtspezifischen Gymnasiastenanteil. Das vermeintlich alarmierende Ergebnis dieses Verfahrens lautet: Arbeiterkinder sind unter Gymnasiasten unterrepräsentiert. Solche Aussagen sind wissenschaftlich und statistisch aber völlig unzulässig. Denn einen Zusammenhang zwischen sozialer Schichtung und Schulniveau gibt es in allen Ländern der Welt – in manchen Ländern der Welt etwas stärker, in anderen Ländern weniger stark als in Deutschland. Vor allem aber: Fünfzehnjährige haben ihre Bildungslaufbahn noch lange nicht abgeschlossen. Sieht man nur die Fünfzehnjährigen, so vernachlässigt man völlig, dass von 100 Studienberechtigten in Deutschland je nach Land zwischen 43 und 50 Prozent diese Studierberechtigung nicht über ein Gymnasium erwerben – und das natürlich erst nach dem 15. Lebensjahr und zu erheblichem Teil aus sog. bildungsferneren Schichten. Auch besteht kein Anlass, jetzt an einer Sachsen-Legende zu stricken und so zu tun, als sei Sachsen deshalb Spitze, weil es keine Hauptschulen habe. Viel entscheidender ist hier, dass die ostdeutschen Länder die naturwissenschaftlichen Fächer mit höheren Stundenzahlen fahren, dass sie aufgrund des dramatischen Geburtenrückgangs mit erheblich kleineren Klassen und mit Fördergruppen arbeiten können und in ihren Klassen nur einen Bruchteil des Migrantenanteils westdeutscher Länder haben. Unter Sachsens Schülern sind es 3,6 Prozent Migranten, in Baden-Württemberg ist der entsprechende Anteil 26,8, in Bayern 18,4 und in NRW 24,9 Prozent (in Finnland übrigens 1,2 Prozent). Das schmälert den Erfolg der Sachsen keineswegs. Vor dem Hintergrund der sehr unterschiedlichen schulischen Rahmenbedingungen aber hat die nordrhein-westfälische Kultusministerin Barbara Sommer nicht so ganz unrecht, wenn sie einen Vergleich der PISA-Ergebnisse ihres Bundeslandes (503 Punkte) mit den 541 sächsischen Punkten für etwas ungerecht hält. Nun, die Kultusminister werden sich in den meisten deutschen Ländern für ein paar Tage freuen dürfen, aber dann gilt es, wieder in die Niederungen zu steigen und konkret etwas für die Schulen zu tun. An vorderster Stelle müssen dabei die Schaffung kleinerer Klassen, die Einrichtung von Förderkursen für schwache und für hochbegabte Schüler sowie die Bewältigung des Lehrermangels in Mathematik und in den naturwissenschaftlichen Fächern stehen. Zugleich darf die PISA-Messerei nicht zum Selbstzweck werden. Andernfalls droht uns ein verarmtes, erbärmliches Verständnis von Bildung. „Bildung statt PISA“ sollte das Motto heißen. Bildung ist schließlich erheblich mehr als das, was PISA misst. PISA hat nämlich überhaupt nichts zu tun mit (fremd-)sprachlicher, literarischer, historischer, politischer, geographischer, religionskundlicher, ethischer und ästhetischer Grundbildung. Wer also meint, es komme nur noch auf PISA-Tabellen an, der degradiert Bildung zum Klonen von Funktions-Fuzzis. Grundprinzip eines seit Jahrhunderten weltweit anerkannten Bildungsverständnisses der Deutschen ist es aber, dass man in der Schule im Interesse von Persönlichkeitsbildung und kultureller Bildung größten Wert eben auch auf das Nicht-Messbare und Übernützliche legt. Also bitte: Nehmen wir PISA-Ergebnisse als interessante Diagnose eines Ausschnitts des schulischen Lerngeschehens, und gehen wir damit so gelassen um, wie es weltweit viele vermeintliche PISA-Sieger und PISA-Verlierer tun. |
||
www.Gesellschaft-und-Visionen.de